Wasserstoff Ratgeber
Energieträger der Zukunft mit besonderem Sicherheitsbedarf
Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger der Energiewende. Als sauberer Brennstoff, Speichermedium und Grundstoff in vielen Industrieprozessen ist er aus modernen Konzepten für Klimaschutz und Dekarbonisierung nicht mehr wegzudenken. Doch so vielseitig und zukunftsfähig Wasserstoff auch ist, im Umgang mit dem leichtesten aller Gase sind besondere Sicherheitsvorkehrungen unerlässlich.
In diesem Ratgeber erfahren Sie, warum Wasserstoff eine Herausforderung für die Gasdetektion darstellt, welche Risiken bestehen und wie Sie Ihre Anlagen zuverlässig schützen.
- Was ist Wasserstoff und warum ist er so besonders?
- Technische Eigenschaften von H₂:
- Herstellung von Wasserstoff:
- Welche Risiken bestehen bei Wasserstoff?
- Lagerung und sicherer Umgang mit Wasserstoff
- Wie erkennt man Wasserstoff zuverlässig?
- Rechtliche Vorgaben und Normen
- Praxisbeispiel: Gaswarntechnik an einer Wasserstoff-Pipeline
- Wasserstoff sicher nutzen – mit der richtigen Gaswarntechnik
- Sie planen eine Anlage mit Wasserstoff?
Was ist Wasserstoff und warum ist er so besonders?
Wasserstoff (H₂) ist ein farb- und geschmackloses Gas und kommt in der Natur fast ausschließlich in gebundener Form vor z. B. im Wasser. Reiner Wasserstoff muss also immer durch technische Verfahren erzeugt werden, z. B. durch Elektrolyse oder Dampfreformierung.
Technische Eigenschaften von H₂:
| Molmasse: | 2,016 g/mol (Typ 5377) |
| Explosionsgrenze (UEG-OEG): | 4 – 77 Vol.-% |
| Zündtemperatur: | ca. 560 °C |
| Geruch: | Geruchslos |
| Dichte (bei 0 °C, 1 atm): | 0,0899 kg/m^3 |
Mit einer unteren Explosionsgrenze von nur 4 Vol.-% ist Wasserstoff hochentzündlich. Schon kleinste Leckagen können bei Funkenbildung oder heißen Oberflächen zur Zündung führen.
Herstellung von Wasserstoff:
Farben, Verfahren und Bedeutung
Wasserstoff ist ein vielseitiger Energieträger, dessen Umweltbilanz stark von der Herstellungsweise abhängt. Um die Klimaziele zu erreichen, unterscheidet man heute vor allem verschiedene Arten von Wasserstoff, die oft mit Farben gekennzeichnet werden:
Pinker Wasserstoff
Wird ebenfalls durch Elektrolyse hergestellt, jedoch mit Strom aus Kernenergie. Er hat eine geringe CO₂-Bilanz, aber die gesellschaftliche Akzeptanz für Kernenergie variiert.
Grauer Wasserstoff
Wird hauptsächlich aus Erdgas (Methan) durch Dampfreformierung (Steam Methane Reforming, SMR) hergestellt. Dabei entstehen erhebliche CO₂-Emissionen, da das Erdgas zerlegt wird. Grauer Wasserstoff ist derzeit die häufigste, aber klimaschädlichste Variante.
Blauer Wasserstoff
Entsteht ebenfalls durch Dampfreformierung, allerdings wird das dabei anfallende CO₂ durch Carbon Capture and Storage (CCS) Technologien aufgefangen und gespeichert. Dadurch verringern sich die Emissionen deutlich, die Herstellung bleibt aber abhängig von fossilen Brennstoffen.
Grüner Wasserstoff
Wird durch die Elektrolyse von Wasser erzeugt, wobei ausschließlich erneuerbare Energien (Wind, Sonne, Wasserkraft) genutzt werden. Grüner Wasserstoff ist klimaneutral und gilt als Schlüssel für die Energiewende.

Weitere Varianten, wie türkisfarbener Wasserstoff (Pyrolyse von Methan mit Feststoffkohle als Nebenprodukt) oder gelber Wasserstoff (Elektrolyse mit Strom aus dem allgemeinen Strommix), werden ebenfalls diskutiert.
Das Verständnis der unterschiedlichen Herstellungsverfahren ist wichtig, da sich daraus Anforderungen an Transport, Lagerung und Sicherheit ergeben und natürlich auch an die ökologische Bewertung.
Typische Anwendungen von Wasserstoff
Wasserstoff findet sich in einer Vielzahl von Anwendungen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen an die Gasüberwachung:
- Chemische Industrie (z. B. Ammoniaksynthese, Hydrierprozesse)
- Metallverarbeitung (z. B. Reduktionsöfen)
- Energiewirtschaft (Power-to-Gas, Brennstoffzellen)
- Mobilität (H₂-Tankstellen, Antriebssysteme)
- Forschung und Labore (z. B. Trägergas in der Gaschromatographie)
In all diesen Bereichen besteht die Notwendigkeit, Gasleckagen schnell zu erkennen, Brände zu verhindern und Mensch wie Anlage zu schützen.

Wasserstoff spielt nicht nur in klassischen Industrieprozessen eine Rolle, sondern auch in innovativen Zukunftstechnologien. Er dient als Kühlmittel in großen Generatoren, als Schutzgas bei der Herstellung von Halbleitern und als Treibgas in der Raumfahrt. In der Lebensmittelindustrie wird H₂ teilweise zum Fetthärten genutzt, während im Energiesektor Pilotprojekte Wasserstoff in Erdgasnetze einspeisen, um fossile Brennstoffe schrittweise zu ersetzen. Auch in der Medizintechnik und bei Spezialschweißverfahren findet er Anwendung. Diese Vielseitigkeit verdeutlicht, dass sichere Handhabung und zuverlässige Gasüberwachung in unterschiedlichsten Umgebungen von entscheidender Bedeutung sind.
Welche Risiken bestehen bei Wasserstoff?
1. Explosionsgefahr
Wasserstoff ist extrem leicht entzündlich. Besonders gefährlich: Da das Gas aufsteigt und sich sehr schnell verteilt, können Zündquellen an ganz anderen Orten zur Explosion führen als die Leckstelle selbst.
2. Unsichtbare Leckagen
Da H₂ geruchlos, farblos und ungiftig ist, bleibt eine Freisetzung ohne geeignete Messtechnik oft unbemerkt – bis es zu spät ist.
3. Materialversprödung
Bestimmte Werkstoffe, insbesondere Metalle, können durch Wasserstoff verspröden und versagen. Ein oft unterschätztes Risiko im Anlagenbetrieb.
Lagerung und sicherer Umgang mit Wasserstoff
Die Lagerung von Wasserstoff stellt besondere Anforderungen an Sicherheit und Technik. Aufgrund seiner geringen Dichte und der hohen Flüchtigkeit muss Wasserstoff unter hohem Druck oder in flüssiger Form gespeichert werden, um wirtschaftliche Volumina zu gewährleisten. Typische Speicherlösungen sind:
Metallhydridspeicher oder andere innovative Speicherverfahren
Druckgasflaschen und Druckbehälter (bis zu 700 bar)
Flüssigwasserstofftanks (bei –253 °C, sehr energieintensiv)

Die Wahl der Speichermethode hängt von Einsatzgebiet, Platzverhältnissen und Sicherheitsanforderungen ab. Druckgasspeicher sind vergleichsweise einfach zu handhaben, benötigen jedoch stabile Hochdruckbehälter und regelmäßige Prüfungen. Flüssigwasserstofftanks ermöglichen hohe Energiedichten, erfordern jedoch eine aufwendige Isolation und Verluste durch Verdampfung sind kaum vermeidbar.
Metallhydridspeicher punkten mit geringem Druck und hoher Sicherheit, sind jedoch schwerer und teurer. Metallhydridspeicher binden Wasserstoff in einer Metalllegierung und geben ihn bei Bedarf wieder frei. Die Entleerung erfolgt durch gezielte Erwärmung des Speichermaterials, wodurch sich der gebundene Wasserstoff löst. Dabei steigt der Dampfdruck im Speicher und das Gas strömt über ein Ventil in die angeschlossene Anlage. Häufig wird dafür elektrische Beheizung oder Abwärme genutzt, um den Prozess zu beschleunigen. Da Metallhydridspeicher mit deutlich niedrigerem Druck arbeiten als Hochdruckbehälter, gelten sie als besonders sicher, eignen sich aber eher für stationäre Anwendungen oder Spezialfälle, bei denen Gewicht keine große Rolle spielt.
Beim Umgang sind folgende Sicherheitsaspekte zentral:
- Vermeidung von Leckagen: Aufgrund der geringen Molekülgröße kann Wasserstoff durch kleinste Ritzen entweichen.
- Explosionsschutz: Die Explosionsgrenzen sind breit, sodass schon geringe Konzentrationen in der Luft gefährlich sind. Deshalb sind geeignete Gaswarnsysteme und Lüftungskonzepte essenziell.
- Materialverträglichkeit: Wasserstoff kann bei bestimmten Metallen Versprödung verursachen. Die Auswahl geeigneter Werkstoffe und Dichtungen ist deshalb kritisch.
- Schulung und Notfallmanagement: Mitarbeiter müssen im Umgang mit Wasserstoff und den möglichen Gefahren geschult sein.
Ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das Lagerung, Transport, Detektion und Reaktion kombiniert, ist der Schlüssel für den sicheren Betrieb.
Wie erkennt man Wasserstoff zuverlässig?
Sensorik für Wasserstoff
Die zuverlässige Detektion von Wasserstoff erfordert Sensorik, die schnell, robust und für explosionsgefährdete Bereiche geeignet ist. Besonders bewährt haben sich folgende Technologien:
Katalytische Sensoren
Diese Sensoren erkennen Wasserstoff über die Wärmetönung bei der katalytischen Oxidation. Sie sind äußerst zuverlässig, robust gegenüber Umwelteinflüssen und ideal für den Explosionsschutz in Industrieumgebungen geeignet. Gerade bei dauerhaften Überwachungsaufgaben haben sich katalytische Sensoren seit Jahrzehnten als Standard etabliert.
Elektrochemische Sensoren
Für niedrigere Konzentrationen, etwa zur Erkennung von Leckagen oder zur Arbeitsplatzüberwachung, bieten elektrochemische Sensoren eine hohe Empfindlichkeit und Selektivität. Sie sind kompakt, wartungsfreundlich und ideal geeignet für personennahe Messungen oder Innenraumanwendungen, in denen auch kleinere Mengen H₂ detektiert werden müssen.

Weitere Technologien, wie Halbleiter-, Wärmeleitfähigkeits- oder optische Sensoren, spielen in Spezialanwendungen eine Rolle, etwa wenn extreme Umweltbedingungen herrschen oder sehr hohe Anforderungen an Langzeitstabilität bestehen. Für viele industrielle Aufgaben sind jedoch katalytische und elektrochemische Sensoren die erste Wahl, wenn es um Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit geht.
Rechtliche Vorgaben und Normen
In explosionsgefährdeten Bereichen gelten unter anderem:
- ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- TRGS 722–724 (Technische Regeln für Gefahrstoffe)
- DIN EN 60079 (Explosionsschutz durch Gerätekonstruktion)
- BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung)
Die Auswahl und Installation von Gassensorik für Wasserstoff sollte immer auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung erfolgen.
Praxisbeispiel: Gaswarntechnik an einer Wasserstoff-Pipeline
Entlang einer Wasserstoff-Pipeline verlaufen sensible Abschnitte, etwa an Ventilstationen, Übergabepunkten oder Kreuzungen mit anderen Versorgungsleitungen. An diesen kritischen Stellen werden fest installierte Gaswarngeräte eingesetzt, um selbst kleinste H₂-Leckagen frühzeitig zu erkennen. Die Sensoren sind so positioniert, dass sie den aufsteigenden Wasserstoff zuverlässig detektieren, bevor sich gefährliche Konzentrationen bilden. Im Alarmfall wird automatisch eine Meldung an die Leitwarte gesendet, die sofort Gegenmaßnahmen einleiten kann – vom Schließen einzelner Abschnitte bis zur Aktivierung von Belüftungssystemen. Diese präventive Überwachung schützt nicht nur Menschen und Umwelt, sondern erhöht auch die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der gesamten Pipeline-Infrastruktur.
Wasserstoff sicher nutzen – mit der richtigen Gaswarntechnik
Wasserstoff ist ein Gas mit enormem Potenzial, aber auch mit besonderen Herausforderungen. Eine durchdachte Gasüberwachung ist der Schlüssel zu einem sicheren und effizienten Einsatz. Wer frühzeitig plant, Risiken kennt und geeignete Sensorik einsetzt, kann Projekte im Wasserstoffbereich sicher realisieren.
Sie planen eine Anlage mit Wasserstoff?
Wir unterstützen Sie gern bei der Auswahl der passenden Gasmesstechnik, vom Konzept bis zur Inbetriebnahme.
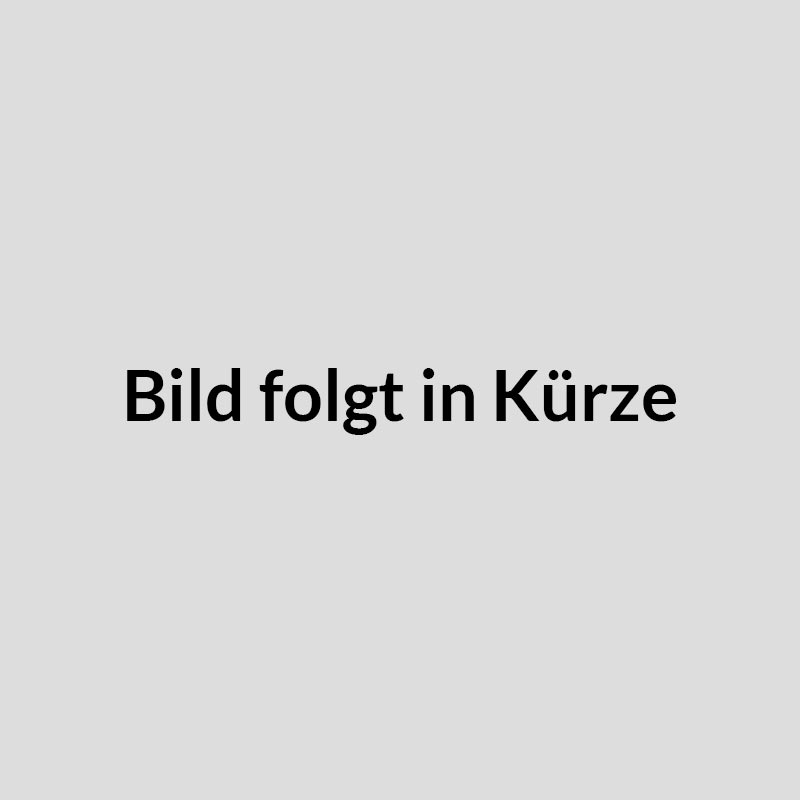
Dr. Hermann Schmidtpott
Geschäftsführer COMPUR MONITORS GmbH & Co. KG
Wir beraten Sie gerne
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.


